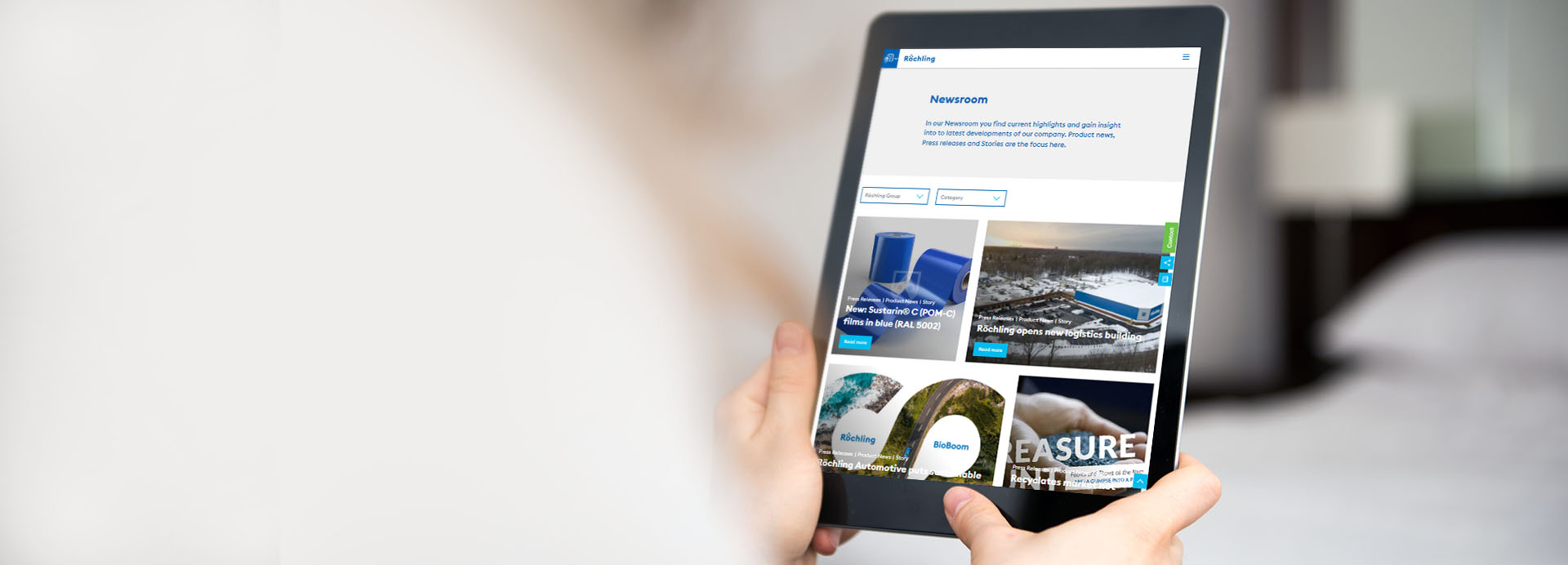
Weitere Röchling News
Besuchen Sie auch den Newsroom der Röchling-Gruppe um aktuelle Meldungen und einen Einblick in die neuesten Entwicklungen unseres Unternehmens zu erhalten.
Röchling Newsroom
Grundsätzlich haben wir Ärzte enorm viele Optionen, uns stehen praktisch alle verschiedenen „Zugänge“ in den menschlichen Körper zur Verfügung. Da ist zum einen natürlich die Haut, die Wirkstoffe resorbieren kann. Wir können etwa Pflaster aufkleben, damit lassen sich Substanzen kontinuierlich über einen längeren Zeitraum an den Körper abgeben. Wir können über Spritzen intramuskulär etwas verabreichen, das wird für die meisten Impfungen eingesetzt. Das ganze Verdauungssystem, von Nase und Mund über die Speiseröhre bis zum Magen-Darm-Trakt, ist ein besonders beliebter Kanal, um Medikamente zu verabreichen: Jede Pille, die man schluckt, gelangt so in den Körper. Bei uns Anästhesisten gehört es zum Alltag, Blutgefäße zu punktieren und so einen Zugang zu legen, um Wirkstoffe direkt in den Blutkreislauf befördern zu können. Dann gibt es noch Inhalatoren für die Lunge, spezielle Nadeln für die Periduralanästhesie am Rückenmark, Zäpfchen für die rektale Anwendung sowie vaginale Verabreichungen. Für alle diese Zugänge gibt es jeweils spezielle Verabreichungssysteme.
Das richtet sich natürlich einerseits sehr stark nach dem Medikament. Wir fragen uns: Welche molekularen Eigenschaften hat es? Wie verhält es sich im Stoffwechsel? Und soll es allmählich oder sofort wirken? Bestimmte Medikamente für bestimmte Indikationen müssen direkt in die Vene injiziert werden, andere können über eine Tablette verabreicht werden. Neben dem Wirkstoff rückt aber bei der Entscheidung, welche Verabreichungsform wir wählen, noch ein ganz anderer Faktor immer mehr in den Vordergrund: die Freiheit des Patienten.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Patient selbstständig und gesund genug ist, sollte er uns für die dauerhafte Einnahme eines Medikaments nicht benötigen. Das ist das Ziel aller – der Ärzte und vor allem auch der Patienten. Deshalb gehen die meisten Entwicklungen im Bereich Verabreichungssysteme in diese Richtung. Man versucht, die Wirkstoffe mit anderen Trägerstoffen so zu koppeln, dass Medikamente, die bislang nur per Injektion verabreicht werden konnten, zunehmend auch oral eingenommen werden können. Dabei bringt man zum Beispiel die Tabletten heute häufig in eine sogenannte Wafer-Form. So kann der Wirkstoff schon in der besonders durchlässigen Mundschleimhaut resorbiert werden.
Für manche Wirkstoffe gibt es Systeme, die das Injizieren – und sei es nur das Stechen in das oberflächliche Fettgewebe – zunehmend überflüssig machen. Ich denke da zum Beispiel an implantierbare Insulinpumpen. Das sind kleine hochtechnologische Kunstwerke, die man 24 Stunden bei sich trägt und die das Leben leichter machen. Damit sind wir bei einer weiteren wichtigen Richtung, in die geforscht wird: Der Komfort des Patienten soll gesteigert werden. Je einfacher und weniger unangenehm die Anwendung, desto besser. Hinzu kommt, dass durch zunehmende Eigenverantwortung seitens der Patienten neue Selbstständigkeit geschaffen wird. Früher musste der Schmerzpatient auf Station für jede Opioid-Gabe noch die Pflegekräfte rufen. Heute hat er eine Pumpe und kann sich selbst seine Schmerzmedikation verabreichen, je nach Bedarf.
Da ist vor allem die Gefahr, dass ein Patient Fehler macht und sich eine viel zu hohe oder niedrige Dosis eines Wirkstoffs verpasst. Daher ist die Frage nach der Sicherheit bei neuen Verabreichungssystemen immer mit die wichtigste. Deshalb gibt es Pillenboxen, die ihr Fach mit den passenden Pillen nur zur richtigen Tageszeit öffnen, Applikatoren, mit denen man sich nur so viele Tabletten in den Mund legen kann, wie man gerade benötigt und Morphinpumpen, die nach einer gewissen Dosis für eine definierte Zeit nichts mehr verabreichen. Die Frage nach der Sicherheit gilt übrigens nicht nur für Verabreichungssysteme, die Patienten selbst kontrollieren. Das gleiche gilt für solche, die von Ärzten gesteuert werden.
Periduralkatheter zum Beispiel, mit denen eine deutlich niedrigere Dosierung notwendig ist als mit Venenkathetern, haben eigene Anschlüsse, die nicht auf Venenkatheter passen. So kommt es weniger wahrscheinlich zu Verwechslungen. Und dann sorgt natürlich auch die stärkere Vernetzung und Digitalisierung für mehr Sicherheit und eine bessere Kontrolle bei der Verabreichung: Heutzutage sind viele Anwendungssysteme direkt mit dem Daten-Management-System des Krankenhauses verbunden, sodass die Verabreichung direkt in die digitale Krankenakte dokumentiert wird. Das ist sehr gut, denn es nimmt uns Dokumentationsarbeit ab und verringert die Fehleranfälligkeit.
So könnte man es zusammenfassen. Und doch wird aller Fortschritt am Ende letztlich immer nur von einer Frage geleitet und bestimmt: Wie bekomme ich einen bestimmten Wirkstoff in einer bestimmten Konzentration möglichst direkt und ohne Nebenwirkungen zu seinem Wirkort im Körper?