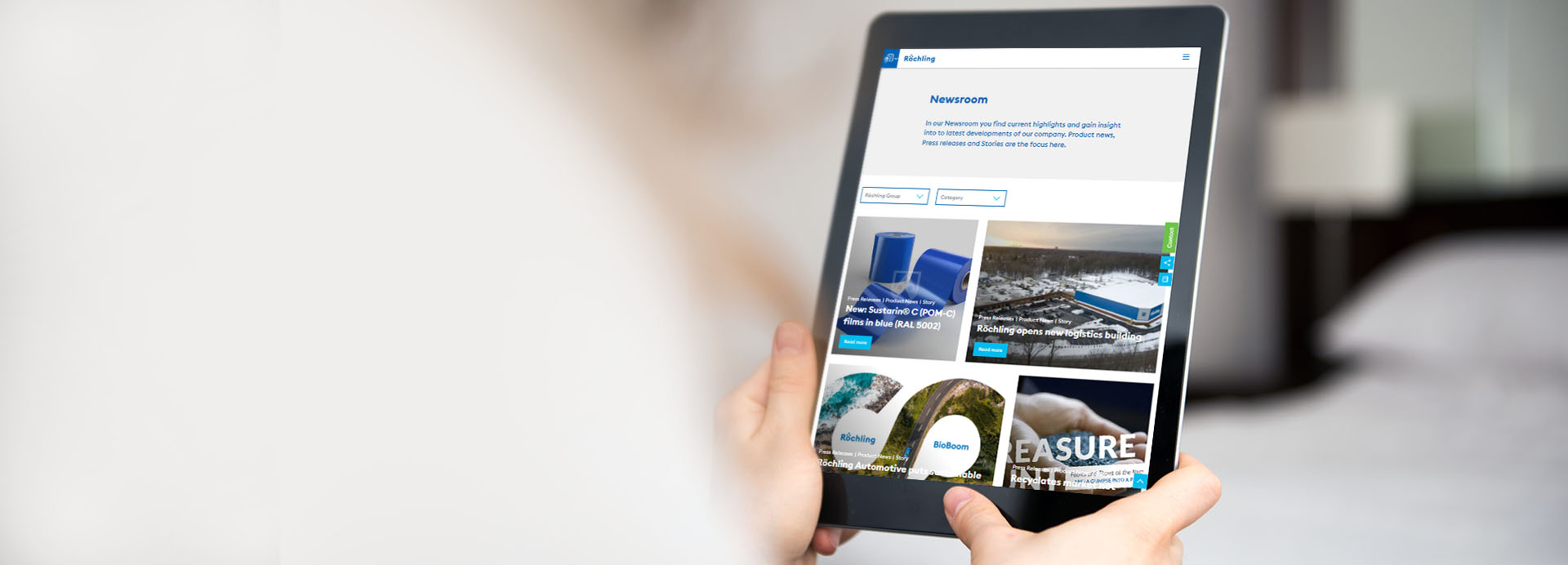Jetzt ist Echtzeit
Von der Diagnose zur Therapie vergeht manchmal viel unnötige Zeit. Doch in Zukunft wird sich das in vielen medizinischen Feldern ändern. Bei sogenannten Closed Loop Systemen laufen Diagnose und Therapie unmittelbar hintereinander und fast automatisch ab – ohne dass wir viel davon mitbekommen.
Die Mühlen der Medizin mahlen langsam? Nicht mehr lange! Heute ist es ja meistens so: Man geht zum Arzt, der entnimmt Blut, schickt es ins Labor, überweist zu anderen Ärzten, damit die einen weiteruntersuchen. Dann, ein paar Wochen später, geht man wieder zum Arzt, erfährt die Ergebnisse und was zu tun ist. Und dann, irgendwann, tut man es auch. Dieses Konzept – Problem verstehen (Diagnose) und dann lösen (Therapie) – ist an sich gut und hat sich bewährt. Aber in vielen Fällen dauert es in der Praxis einfach sehr lange. Wie wäre es, wenn beides direkt miteinander verknüpft wäre? Und das, ohne dass es uns besonders stört?
„Die Medizin ist auf einem guten Weg dorthin, teilweise ist sie sogar schon angekommen“, sagt Sebastian Koller, Leiter des Bereichs Innovation und Produktentwicklung bei Röchling Medical Waldachtal. Das große Ziel sind sogenannte „Closed Loops“, die Ärzten und Patienten das Leben erleichtern sollen. In einem Closed Loop, also einer Art in sich geschlossener Regelkreis, sind Diagnostik und Therapie digital miteinander verbunden.
Kunststoff bietet viele Vorteile bei der Entwicklung von Biosensoren
Eine Reihe von Herausforderungen muss bis dahin allerdings noch gemeistert werden: „Wir versuchen Wege zu finden, um den Patienten vor der Elektronik und die Elektronik gleichzeitig vor den Körperflüssigkeiten des Menschen zu schützen“, sagt Koller.
Experten bei Röchling forschen deshalb an implantierbaren Biosensoren und Kunststoffprodukten der nächsten Generation, die im Körper kaum Abstoßungs- und Immunreaktionen hervorrufen. Kunststoff, der Kernbereich der Röchling-Gruppe, bietet hier besonders viele Möglichkeiten: „Man kann Kunststoff im Grunde formen, wie man will. Das ist ein riesiger Vorteil“, sagt Koller.
Im Grunde ein Schritt: Blutzucker messen – Insulin spritzen
Ein Beispiel aus dem Feld Diabetes. Zurzeit werden Pflaster entwickelt, die mit kleinen Nädelchen in die Haut ragen und dort sowohl den Blutzucker messen, als auch Insulin freigeben. In einem Closed Loop würde beides automatisch ablaufen und aufeinander reagieren: Das Pflaster misst den Blutzuckerspiegel, wertet ihn aus – und spritzt die entsprechende Menge an Insulin.
Damit ein Closed Loop verlässlich und reibungslos funktioniert, braucht es eine Reihe moderner Komponenten. „Am Anfang steht eine gute Sensorik: Temperaturfühler, Lagerezeptoren, Licht- und Farbsensoren. Die Auswahl ist beinahe unbegrenzt und kann auf die Anwendung angepasst werden“, sagt Koller.
Aber mit Sensorik allein gibt es keine Therapie. Deshalb ist auch die Kommunikation der verschiedenen Bestandteile untereinander entscheidend, von Kabeln bis hin zur drahtlosen Datenübertragung wird hier derzeit alles erprobt. Das richtige Material spielt eine entscheidende Rolle: „Wir forschen hier an Sensoren und Kunststoffen, die vom Körper nicht als Fremdkörper erkannt werden“, sagt Koller.
Bettunterlagen messen Druckbelastung. Windeln melden, wenn sie voll sind
Doch nicht immer muss der Closed Loop auch direkt im Körper stattfinden. Es gibt auch Bettunterlagen mit elektronischen Sensoren, die messen, an welcher Stelle der Patient mit welchem Druck im Bett liegt. Ist die Position des Patienten über lange Zeit unverändert oder sind die Druckverhältnisse ungünstig, wird durch eine Veränderung der Unterlage – etwa mit Luftpolsterung – bewirkt, dass es beim Liegen nicht zu Druckstellen oder gar offenen Wunden wie Dekubitus kommt.
Es gibt zahllose Einsatzfelder, die derzeit erprobt werden. „Bei der minimalinvasiven Chirurgie zum Beispiel wird daran geforscht, vom Patienten ein Profil zu erstellen, in dem ausgewertet wird, wie er sich bewegt, wie die Vitalparameter sind und welche Besonderheiten er aufweist, um die folgende Therapie an den Patienten anzupassen“, erzählt Koller. Und im Bereich Pädiatrie oder Geriatrie werden Windeln entwickelt, die Alarm geben, wenn sie voll sind.
Natürlich kann man sich auch vorstellen, dass die Daten, die ein Sensor erfasst, direkt über das Internet an die Klinik oder den Arzt übertragen werden. „Im Grunde ist das eine prima Idee, die sich vielleicht irgendwann auch durchsetzen wird. Aber zurzeit wird hier die Gefahr des Missbrauchs noch über den direkten Nutzen für den Patienten gesetzt“, sagt Koller. Entsprechend gering ist noch die Bereitschaft auf Seiten der Betroffenen, einem Transfer von persönlichen Daten zuzustimmen. Meistens ist das auch gar nicht nötig, wenn der gesamte Regelkreis in sich geschlossen ist und keine Kontrollinstanz wie eine Klinik oder ein Arzt gebraucht wird.
Wer zu wenig Sauerstoff hat, bekommt automatisch mehr davon
So, wie im Fall der Überwachung der Sauerstoffsättigung. Über einen Sensor am Finger kann in den Intensivstationen der Kliniken kontinuierlich die Sauerstoffsättigung gemessen werden. Werden die Ergebnisse direkt ausgewertet und in entsprechende Handlungsanweisungen an das Sauerstoffgerät umgewandelt, so dass man beispielsweise bei entsprechendem Bedarf mehr Sauerstoff bekommt. Sauerstoffbedarf und Sauerstoffversorgung regeln sich von selbst, ohne dass Patienten, Pflegekräfte oder Ärzte hier ständig kontrollieren müssen.
Für Patienten sind Closed Loops eine große Erleichterung. Nicht nur, weil sie schneller behandelt werden. Es läuft oft auch von selbst ab, ohne, dass man sich damit groß beschäftigen muss. Und es bringt ein Stück Lebensqualität, man spart sich Besuche in der Arztpraxis. Entsprechend sind die Closed Loops auch für Ärzte entlastend. Denn die haben dann wieder mehr Zeit dafür, sich mit dem Patienten zu beschäftigen – und nicht nur mit seinen Krankheiten. Und auch beim Therapieerfolg und der Lebensqualität zeichnet sich ab, dass Closed Loops in vielen Fällen vorteilhaft sind. Kein Wunder, mit Diagnose und Therapie rückt hier ja auch etwas zusammen, was zusammengehört.